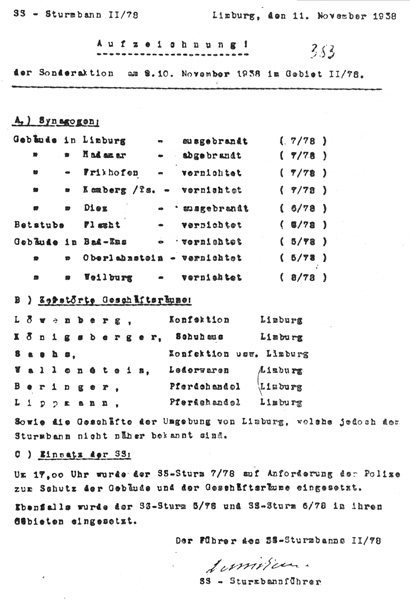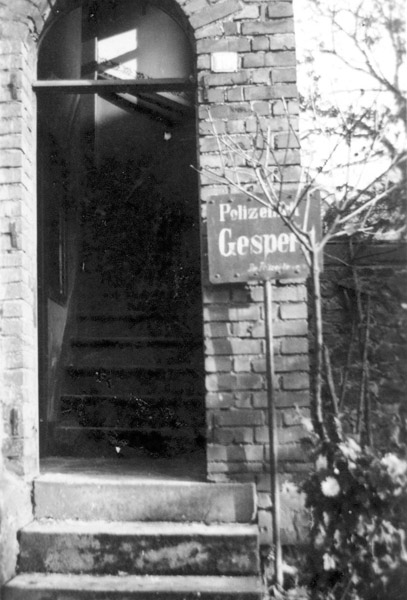Woher kam
der Hass?
„Das ist
nicht das Land, das meine Eltern
getötet hat. Nicht die Deutschen haben uns drangsaliert. Es
waren die
Hitlerleute, die Nazis.“
Von Hubert Hecker.
Seit dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) wohnten
Juden in der Westerwälder Landgemeinde
Frickhofen. Frickhofen befindet sich rund 80 Kilometer nordwestlich von
Frankfurt am Main.
Um 1820 lebten im Ort drei jüdische
Viehhändlerfamilien. Ihre Kinder besuchten
die gemeinsame Dorfschule. Im Jahre 1841 wurden die Juden durch ein
herzogliches
Edikt den „christlichen Untertanen gleichgestellt“.
Laut einer Statistik von 1843 betreiben im Herzogtum Nassau 80% der
Juden einen
Handel. Darum lobte der Frankfurter Bankier Amschel Mayer Rothschild
tausend
Gulden als Lehrgeld aus, damit die „israelitischen Jungen
gewerbliche Berufe
lernen“.
Aus Frickhofen meldeten sich Nathan Kaiser und Jacob Heilbrunn zum
Wollweber-
und Schreinerberuf. Aber nach der Lehrzeit kamen sie doch wieder zur
Viehhändlerei.
Die Preußen brachten im Jahr 1866 liberale Religionsgesetze
ins Land. In dieser
Zeit trat ein gewisser Sußmann Kaiser aus der
örtlichen Kultgemeinde aus. Da
starb seine Frau und es stellte sich die Frage nach der Beerdigung.
Kaiser wurde mit der Alternative konfrontiert: dreißig Taler
für die Beerdigung
auf dem nächsten jüdischen Friedhof im Dorf Ellar
oder fünf Taler Jahresbeitrag
in der israelitischen Ortsgemeinde.
Kaiser entschied sich für die fünf Taler. Schon eine
Woche nach der Beerdigung
seiner Frau trat er aber erneut aus der Ortsgemeinde aus.
Um 1890 wurde in einer Doppelhaushälfte eine kleine Synagoge
eingerichtet:
sechs Bankreihen unten und die abgetrennte Frauenempore oben.
In dieser Zeit lebten sechs Viehhändlerfamilien im Ort. Zwei
jüdische Soldaten
fielen im Ersten Weltkrieg für Kaiser und
Vaterland – vier jüdische
Frickhöfer kehrten wieder heim.
Nach dem Krieg begann im Dorf ein reiches Vereinsleben. Juden wurden
Mitglieder
im Fußballverein und bei der Feuerwehr. Der Jude Erich Wolf
leitete zwei Jahre
den Turnverein.
Julius Kaiser war ein eifriger Benützer der katholischen
Pfarrbücherei. Sein
katholischer Freund Toni Schardt besuchte ihn gerne zum
Laubhüttenfest.Auf den
Dorffesten waren die jungen Männer aus jüdischen
Familien begehrte Tänzer für
Charlston und Walzer.
Zur goldenen Hochzeit von Rebecca und Sigmund Heilbrunn sang der
Männergesangverein.
Christen und Juden legten Wert auf gute Nachbarschaft, gegenseitige
Hilfe im
Alltag, gegenseitige Einladungen bei Familienfesten und Trauerfeiern.
Viele christliche Mädchen aus dem Dorf gingen bei reichen
Frankfurter Juden als
Hausmädchen „in
Stellung“ – allerdings mit der elterlichen
Warnung: Juden
dürften nach Talmud-Lehre christliche Mädchen
„nehmen“.
Auch bei der Viehhändlerei gab es nicht nur Minne. Die Ferkel
wirkten im Stall
„irgendwie kleiner“ als auf dem Viehwagen gesehen.
Und: „Gegen die Juden
verlierst du jeden Rechtsstreit. Die haben ihre Rechtsanwälte
in der Stadt.“
Doch in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kommt das soziale
und
politische Gefüge in Frickhofen durcheinander:
1932 marschiert erstmals die nationalsozialistische
„Schutz-Abteilung“ durch
den Ort. Bei den letzten freien Wahlen im November 1932 bekommen die
Nationalsozialisten 40% der Stimmen.
Im Jahr 1934 verbietet die Hitler-Partei dem örtlichen
Metzgermeister, den
jungen Siegfried Rosenthal als Lehrling einzustellen. Rosenthal lernt
daraufhin
Bäcker in Kassel. Sein Bruder Feodor hat ihm die Lehrstelle
besorgt.
Doch so richtig beginnen die Schikanen 1936 – nach
den Olympischen Spielen
in Berlin. Die sechs jüdischen Viehhändler verlieren
ihre Gewerbelizenz.
Dennoch verkaufen ihnen die Bauern ihr Vieh
weiterhin – heimlich und
nachts von der Weide.
„Erst greifen sie nach dem Knoblauch“, den Juden
also – sagt der alte
Salomon Kaiser – „dann holen sie den
Weihrauch“, also die Katholiken.
Tatsächlich beginnt die Hitlerpartei ab 1937 einen
verschärften Kampf gegen die
Katholiken. Die Nationalsozialisten verbieten im Ort die katholischen
Vereine:
Katholischen Jungmänner-Bund und Pfadfinder, Marien- und
Frauenverein.
Hitlerleute reißen die Fronleichnamsfahnen aus den
Hausfenstern katholischer
Familien. Der Kaplan wird bespitzelt. Vier katholische Jugendliche
bekommen je
einen Monat Lagerhaft wegen Unbotmäßigkeit
gegenüber Parteieinrichtungen.
Am 9. November 1938 geht es den ungefähr zwanzig
jüdischen Dorfbewohnern an den
Kragen.
Der Innenraum der kleinen Frickhöfer Synagoge wird
verwüstet. SA-Horden
überfallen die Häuser der jüdischen Familien
und werfen Geschirr und
Einmachgläser auf die Straße.
Der Jude Rudolf Hofmann versteckt sich unterm Heu in einer Scheune und
wird mit
Heugabeln herausgestochen.
Drei jüdische Männer kommen für zwei Monate
ins Konzentrationslager Buchenwald.
Fünf jüdische Kinder werden ausgeschult.
Zwei Familien beantragen in den USA Asyl. Aber die restriktive Quote
von 10.000
Flüchtlingen ist schon Ende Januar 1939
voll – erzählt der Frickhöfer
Harry Abraham später.
Im April 1939 gelingt es fünf Personen –
darunter Siegfried
Rosenthal –, über Genua nach Schanghai
auszureisen.
Die 15 verbliebenen Juden werden enteignet und in einem
„Judenhaus“
zusammengepfercht.
Sie überleben nur, weil ihre christlichen Nachbarn sie
heimlich mit Milch und
Brot versorgen, ihre Schuhe und Kleider reparieren oder mit Schulheften
und
Zeitungen versorgen.
Für die angekündigte „Ausreise nach
Polen“ stellen die Dorfbewohner den
bedrängten Juden Winterkleidung bereit.
Im August 1942 werden 15 Personen mit dreifacher Kleidung und schmalem
Gepäck
zum Bahnhof abgeführt.
Ein Lehrer und eine Nachbarin fahren ihnen nach Frankfurt nach und
berichten im
Ort, daß die Frickhöfer Juden in einer Halle
kampieren und auf den Abtransport
warten.
Nach dem Krieg konnte der Tod von 11 Personen in den
Konzentrationslagern von
Theresienstadt, Treblinka, Sobibor, Majdanek und Auschwitz nachgewiesen
werden.
Die übrigen mußten für „tot
erklärt“ werden.
Ein entkommener Frickhöfer Jude, Siegfried Rosenthal,
ließ sich im Jahr 1948 in
Haifa im neu entstandenen Staat Israel nieder.
1967 kommt er zum erstenmal in seinen Geburtsort zurück. Er
nimmt regelmäßig an
den Klassentreffen seiner alten Volksschulklasse teil.
Nach seiner Pensionierung im Jahre 1982 verbringt er jedes Jahr zwei
Sommermonate in seiner deutschen Heimat – Heimat?
Das Land, das seine
Eltern umgebracht hat?
„Nein“ – antwortet Rosenthal:
„Das ist nicht das Land, das meine Eltern
getötet hat. Nicht die Deutschen haben uns drangsaliert. Es
waren die
Hitlerleute, die Nazis“ – sagt er.
Den Umgang mit den ehemaligen SA-Leuten und der Nazi-Kneipe meidet er.
„Deutsch ist meine Muttersprache, Deutschland ist meine erste
Heimat, Israel
meine zweite“, bekennt er.
65 Jahre nach der nationalsozialistischen Pogromnacht von 1938
organisiert der
Autor dieser Zeilen ein Treffen.
Eine Broschüre wird geschrieben, eine Tafel am Rathaus
angebracht. Aus Israel,
Südafrika und den USA kommen die ehemaligen
deutsch-jüdischen Mitbürger des
Ortes oder die Kinder der inzwischen Verstorbenen.
Im Pfarrzentrum ist eine kleine Ausstellung aufgebaut. Mehr als achtzig
alte
und junge Ortsbewohner sind neugierig auf die Ehemaligen und ihre
Reaktionen.
Sogar der alte Wirt aus der Nazi-Kneipe ist gekommen.
Siegfried Rosenthal ergreift das Wort und erzählt von
nationalsozialistischen
Schikanen und Nazi-Schlägern – und immer
wieder von guten Menschen und
hilfreichen Nachbarn.
Zuletzt spricht der Organisator des Treffens: „300 Jahre
haben in diesem Ort
Christen und Juden in guter Nachbarschaft und dörflicher
Gemeinschaft
zusammengelebt.
Die böse Saat von Haß und Hetze auf die Juden kam
von außen in den Ort und hat
auch hier häßliche Früchte getragen.
Die nationalsozialistische Partei und ihre heidnisch-rassistische
Ideologie
haben in nur zehn Jahren die Gemeinde gespalten, den Frieden
zerstört, die
jüdischen Mitbürger verfolgt, vertrieben oder
vernichtet.
Seien wir wachsam auf gottlose Eiferer, vernunftlose Hetzer und
totalitäre
Tendenzen.“

Siegfried
Rosenthal auf dem Gedenk-Friedhof der ehemaligen
jüdischen Gemeinden von
Frickhofen und Langendernbach





ten
die
die beiden Ex-Frickhöfer Feodor (*1908) und Siegfried
Rosenthal (* 1919) auf
eigene Initiative die alten Grabsteine weg und errichteten die Friedhof
völlig
neu zu seinem jetzigen Zustand.
Siegfried
Rosenthal mit seiner Frau Elisabeth am Grab seiner Großeltern
Siegmund und
Rebeka Heilbrunn, die beide 1936 starben und
begraben wurden


Siegfried
Rosenthal vor dem Frickhöfer Rathaus
 Siegfried
Rosenthal vor der 1841
erbauten Hadamarer Synagoge. In einem Nebenraum des Gebetshauses wurde
Rosenthal als Schüler an den Sabbattagen in Hebräisch
und jüdischer
Religionslehre unterrichtet.
Siegfried
Rosenthal vor der 1841
erbauten Hadamarer Synagoge. In einem Nebenraum des Gebetshauses wurde
Rosenthal als Schüler an den Sabbattagen in Hebräisch
und jüdischer
Religionslehre unterrichtet.
Siegfried Rosenthal vor der 1841 erbauten Hadamarer Synagoge.
In einem Nebenraum des Gebetshauses wurde Rosenthal als Schüler an den Sabbattagen in Hebräisch
und jüdischer Religionslehre unterrichtet.


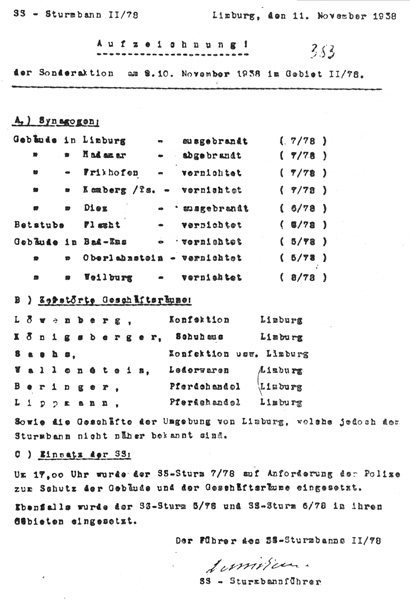
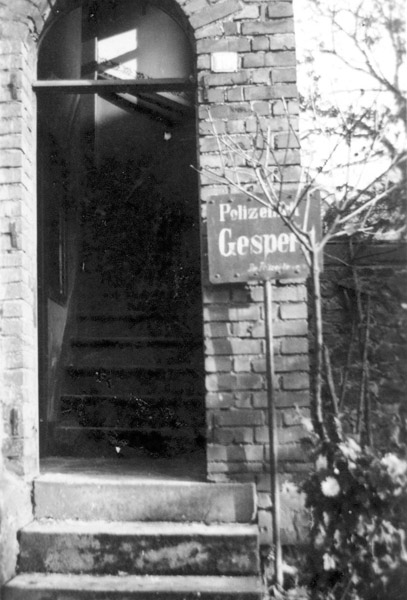

Häftlinge des KZ
Buchenwald bei Erdarbeiten, Dezember 1938. Im Vordergrund: Albrecht
Abraham aus Frickhofen.

Hebräische
Aufschrift auf der Tafel: Talmud Torah Schanghai
5706 (1945/46)
Nach
dem Novemberpogrom und dem KZ-Aufenthalt von drei Frickhöfer
Juden setzte
die Familie Abrahan alles daran, aus Deutschland zu emigrieren. Im
Frühjahr
1939 hatten aber alle europäischen und amerikanischen Staaten
sowie Australien
für jüdische Auswanderer die Schotten dicht gemacht.
In den USA war die
Einwanderungsquote schon Ende Januar 1939 erreicht. Als letzter
Zufluchtsort für
deutsche Juden blieb Shanghai, damals unter japanischer Besatzung. Seit
Januar
1939 hatte sich Ida Abraham intensiv um eine Schiffsreise nach Shanghai
bemüht.
Schließlich konnte sie fünf Passagierplätze
reservieren lassen für die
Schiffspassage von Genua nach Shanghai. So konnten sich im April 1939
– vier
Monate vor Kriegsbeginn – fünf Frickhöfer
Juden in Sicherheit bringen: Ida und
Albrecht Abraham mit Sohn Harry, Schwager Siegfried Rosenthal und
Richard
Hoffmann.
In Schanghai lebten während des Krieges –
unter japanischer Duldung –
ca. 18.000 Juden, hauptsächlich aus Deutschland, die ein
eigenes
deutschsprechendes Gemeinwesen aufgebaut hatten.