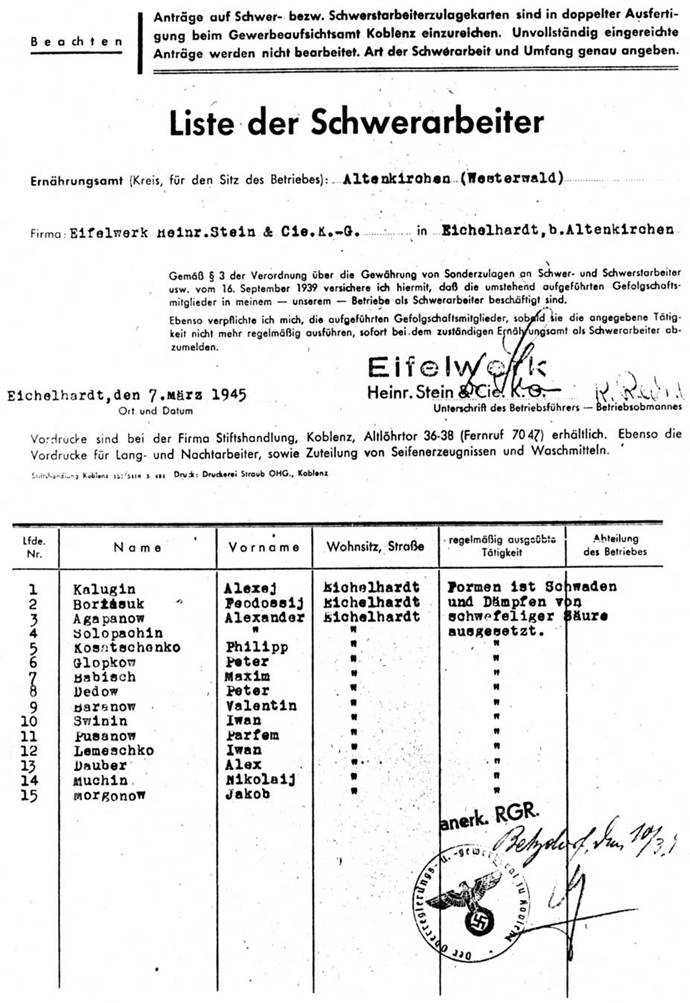Günter Heuzeroth
Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter
während des Zweiten Weltkrieges im Westerwald
III. Teil
(veröffentlicht im Heimatbuch 1987 des Kreisheimatvereins Altenkirchen - hier
veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Heimatvereins)
Auf dem Eifelwerk Metallgießerei und Metallwaren der Fa.
Heinrich Stein & Cie KG in Eichelhardt waren in den Kriegsjahren ständig
Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter (Frauen und Männer) aus dem Osten
eingesetzt. Nach der entsprechenden Arbeitsbedarfsmeldung vermittelte das
zuständige Landesarbeitsamt in Neuwied diesen Personenkreis. Erhaltengebliebene
Unterlagen
vom Besitzer des heute noch bestehenden Werkes geben einen differenzierten Aufschluß und Überblick
über den Einsatz von Ausländern im Werk, das auf der ehemaligen Grube Petersbach
seinen Standort hat, in der schon im Ersten Weltkrieg 1914/18 französische und englische
Kriegsgefangene eingesetzt waren.
Im Dezember 1941 erhielt der Betrieb vierzehn belgische
Kriegsgefangene (Kgf) zugeteilt, die im Frühjahr 1942 mit
russischen Kriegsgefangenen teilweise ausgetauscht wurden. Bis 1945 haben in
diesem Leichtmetallwerk dreizehn französische Kriegsgefangene überwiegend als
Reparaturschlosser, Dreher oder Schreiner gearbeitet. In der Küche und im
Betrieb waren fünf Ostarbeiterinnen eingesetzt. Ein Verzeichnis aus dem Jahr
1945 weist aus, daß dreißig sowjetische Kriegsgefangene als
Sandformer, Kernformer, Gußputzer, Schmelzer,
Schmied, Elektriker und in der Küche gearbeitet haben. Im Betrieb wurden
überwiegend Leichtmetallklemmen für Batterien und später „kriegswichtiges Ergänzungsmaterial“
hergestellt. Die Kriegsgefangenen kamen aus den Stammlagern Limburg und Trier
bzw. aus einem Durchgangslager in der Nähe von Westerburg. Auf dem
Werksgelände waren diese und Ostarbeiter in Baracken untergebracht. Unter den Ostarbeitern
befanden sich auch Familien mit Kindern. Verpflegt wurden die Personen aus der zur Verfügung
gestellten Küche, die die Ernährung, somit das Kochen und die Verteilung der Verpflegung,
sicherzustellen hatte. Die Einkäufe wie die Verteilung der Lebensmittel wurden korrekt in
das Küchenbuch und in Bestellisten aufgeführt. In
einer Liste über die Zuteilung von Brotrationen und Margarine für Ostarbeiter
und Kriegsgefangene“ werden folgende Angaben gemacht:
1 Normalverbraucher erhält in 1 Tag = 318, g Brot
1 Lagerarbeiter erhält in 1 Tag = 386, g Brot
1 Schwerarbeiter erhält in 1 Tag = 450 g Brot
1 Kind erhält in 1 Tag = 179 g Brot
Margarine
erhält pro Mann 1 Tag = 24,7 g
Die übrige kommt ins Essen.
Marmelade und andere Nährmittel wurden
entsprechend der damaligen schwierigen Ernährungslage knapp und rationalisiert
zugewiesen.
Die Lebensmittelsendungen erfolgten aufgrund einer
erstellten Bedarfsmeldung, die von der Anzahl der eingesetzten Zwangsarbeiter
ausging und die in entsprechenden Arbeitskategorien eingeteilt waren.
Das zuständige Ernährungsamt in Altenkirchen und Wissen war verpflichtet, die angeforderte
Ernährung sicherzustellen.
Heinrich Stein berichtet, daß
bei der zunehmenden kritischen Kriegslage sich die Ernährungssituation manchmal
beängstigend verschlechtert habe. Erhebliche Liefermängel seien für den Betrieb, was die
Verpflegung betroffen habe, aufgetreten. In der Küche arbeitete u. a. die Frau
des Betriebsmeisters
Karl Rediger aus Isert mit.
Schwierig war auch die Versorgung der Kinder mit Milch, die nicht immer in der
benötigten Menge aufzutreiben gewesen sei. Heinrich Stein selbst sowie sein
Betriebsmeister Karl Rediger und einige Ausländer
bemühten sich, zusätzliche Feldfrüchte zu besorgen, um eine Mindesernährung
sicherzustellen. Sie zogen zu Fuß mit
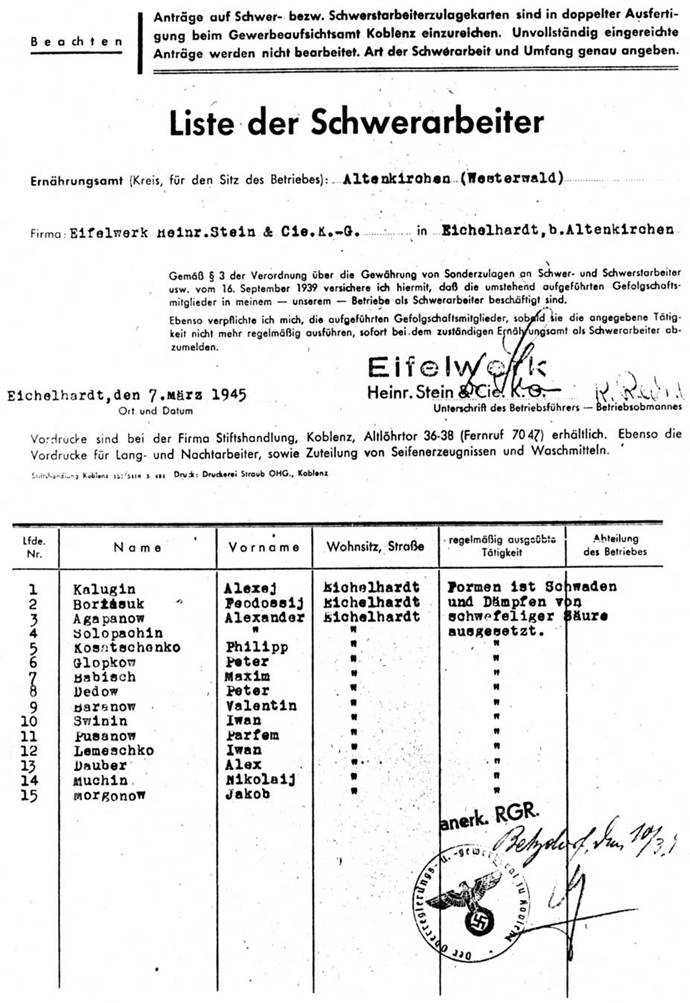
einem Handwägelchen über die Nisterdörfer
zu den Bauern und suchten um Mehl, Kartoffeln und Fett nach. Beim Landhandelbetrieb
Karl Ewald Müller auf dem Ingelbacher Bahnhof erhielten sie
öfters grüne gewässerte Erbsen und Hirse für die Küchenverpflegung des
Betriebes.
Stein berichtet, daß die
Arbeiter gewußt hätten, wie sie sich für eine
möglichst ausreichende Ernährung eingesetzt hätten. Nur wenige hätten versucht von
ihren Arbeitsstellen wegzulaufen, obwohl die Arbeit oft recht schmutzig gewesen
sei. Die meisten von ihnen seien dann von der Gestapo oder der Polizei in der Nähe
von Koblenz wieder aufgegriffen und zurückgebracht worden. Deutsche
Arbeiter konnten die Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene nach Feierabend für den
Erntedienst bei sich zu hause mitnehmen. Für die „Leiharbeiter“ war das sicher
nach einem Achtstundentag eine zusätzliche Belastung. Sie haben es aber meist
gerne getan, weil sie hier zusätzliches Essen und meist auch freundliche
Behandlung bekamen und erfuhren. Auch mein Vater brachte zwei sowjetische
Kriegsgefangene einige Tage zur Heuernte mit. Wir haben viel herumgealbert
mit ihnen und wurden gute Freunde. Einer von ihnen hieß Nikolaij,
er blieb mir in guter
Erinnerung.
Am 10. Februar 1945, einige Monate vor Kriegsschluß, warfen Kampfflugzeuge Bomben auf den Betrieb des Eifelwerkes
in Eichelhardt ab. Neben erheblichen Gebäudeschäden
waren vor allem Menschenleben zu beklagen gewesen. Die Baracke mit den sowjetischen
Kriegsgefangenen wurde total zertrümmert. Von dreiunddreißig Ausländern
wurden acht Personen getötet, vier schwer verletzt und zwei kamen mit leichten
Verletzungen davon. Zum eigenen Schutz waren schon während des Angriffes die
meisten Arbeiter in den naheliegenden Wald gelaufen.
Die meisten
Opfer waren durch die Detonation einer schweren Sprengbombe und die darauf
herunterstürzenden
Eisenträger, Balken und das Gemäuer erschlagen worden. Leider befand sich auch
mein sowjetischer Freund Nikolaij unter den
Todesopfern. Ich weiß noch, daß ich ganz traurig darüber
war. Die Schwerverletzten wurden nach Wissen ins Krankenhaus transportiert. Dort sind dann
die Verstorbenen von Heinrich Stein und Karl Rediger
identifiziert worden.
Abschrift
vom Original
eines Schreibens vom
Eifelwerk in Eichelhardt an das Ernährungsamt in
Altenkirchen
An
das Ernährungsamt abt. B
Altenkirchen/Westerwald
18. Januar 1944 Dr.
St./Schl. -em.kgf.
Ernährung - Ostarbeiter
Von
den uns zugeteilten 23 Ostarbeitern sind am 9. Januar 1944 Triko
Alexander, Alter 2 Jahre und Triko Wolentia,
Alter 1 Jahr gestorben.
Am 12. Januar 1944 sind 4 weitere und zwar Shuk Wanrowa, Alter 44 Jahre und Shuk Maria, Alter 8 Jahre, sowie Triko Anna, Alter 24 Jahre und Triko
Lübow, Alter 28 Jahre aus der Gemeinschaftsverpflegung
ausgeschieden. Am 19. Januar 1944 gehen außerdem noch
folgende Ostarbeiter ab:
Schabanowa,
Pelageja Alter 66 Jahre
Schabanowa,
Katharina Alter 21 Jahre
Schabanowa,
Alexander Alter 15 Jahre
Triko, Alexandrowa Alter 47 Jahre
Triko,
Tatjana Alter 31 Jahre
Triko,
Natalia Alter 65 Jahre
Triko, Wolentina Alter 8
Jahre
Kalinkowski, Lukerja Alter 40 Jahre
Kalinkowski,
Michael Alter 14 Jahre
Kalinkowski,
Katerina Alter 6
Jahre
Es sind demnach nur noch
folgende Ostarbeiter bei uns:
Shuk,
Juris Alter 42 Jahre
Shuk, Clena Alter 32 Jahre
Shuk,
Sonja Alter 13 Jahre
Shuk,
Nikolaj Alter 8
Jahre
Tschernowa,
Elisaweta Alter 59 Jahre
Tschernowa,
Maria Alter 22 Jahre
Tschernowa,
Peter Alter 11 Jahre
Wir bitten beiliegende
Lebensmittelscheine dementsprechend umzuändern und wieder zuzustellen.
Heil
Hitler!
Kurz vor Kriegsschluß wurden
die Ausländer aus der ganzen heimischen Gegend, unter denen sich auch die vom
Eifelwerk befanden, in ein Zentrallager nach Westerburg transportiert. Als der Krieg zu Ende
war, kamen einige Ukrainer und andere Zwangsarbeiter bei der Familie Stein in Eichelhardt vorbei und brachten ihnen Lebensmittel mit.
Eine Geste der Dankbarkeit dafür, daß zumindest in diesem
Werk keine Menschenschinderei passierte!
Kriegsgefangene
und ukrainische Zwangsarbeiter in der Siegerländer Eisenerzgewinnung des Westerwaldes
Den wenigsten Leuten in unserer Heimat dürfte bekannt
sein, daß der größte Einsatz von Kriegsgefangenen
und Zwangsarbeitern zur Sklavenarbeit in unserer heimischen Eisenerz- und Verhüttungsindustrie stattgefunden hat.
An präzises Material heranzukommen, welches genauere Aufschlüsse haben könnte, ist mühsam und zum Teil
ausgeschlossen. Der Siegerländer
Erzbergbau mit seinem Hüttenwesen gehört seit über zwanzig Jahren der Vergangenheit
an. Die Betriebe sind zum größten
Teil geschlossen oder zweckentfremdet worden. Die Akten, welche die Nachweise über den personellen Einsatz
vor allem des angegeben Personenkreises betreffen, wurden überwiegend vernichtet bzw. gingen verloren. Die
Recherchen über den Einsatz von
Ausländern während der Kriegszeit kommen weitgehend zu spät. In den Versicherungsakten der Krankenkassen wären noch
Unterlagen über die Personen zu finden gewesen, wenn sie aufbewahrt worden wären.Noch
vorhandene Karteikarten sind alphabetisch geordnet und nur unter enormem
Zeitaufwand auffindbar.
Auf Anfrage bei der Nachfolge-Auffanggesellschaft der
Betriebe der Siegerländer Eisenerzbergwerke und Hütten, „Barbara Rohstoffbetriebe
GmbH“ wurde mitgeteilt, daß ihres Wissens in den
Grubenbetrieben des Siegerlandes überwiegend Ausländer aus Rußland,
Polen und Italien über und unter Tage eingesetzt gewesen seien. Sie wurden
aus werkseigenen Kantinen und Küchen verpflegt und in den auf dem
Betriebsgelände errichteten Baracken untergebracht. Die „Ruhrknappschaft“
berichtete, daß in ihren Betrieben des
Westerwaldes/Sieg etwa 1.300 Franzosen zu arbeiten verpflichtet gewesen seien,
dazu Polen, Ukrainer und Weißrussen. Die Betriebe in der Eisenerzgewinnung
gehörten alle zur „Ruhrknappschaft“. Die Angaben beziehen sich somit auf die eisenerzgewinnende Industrie des Westerwaldes. Durch
Befragen von einzelnen Bergleuten wie vor allem Steiger und Hauer, die während
des Krieges im Bergbau tätig gewesen waren, konnten noch zusätzliche Informationen
über den Einsatz von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern gewonnen werden. Gustaf Käsgen aus Bruchertseifen berichtet,
daß auf der ehemaligen „Alten Hütte“ auf dem Aiserberg in Wissen etwa 25 Ukrainer an der Aufbereitung der Rösteöfen und
ca. 20 Ukrainerinnen an den Erzaufbereitungsbändern beschäftigt gewesen seien. Auch habe
man darüberhinaus einige Polen zu Arbeiten im Betrieb
eingesetzt. Die Frauen hätten in den am Alzerberg/Pirzenthalerweg und auf der Grube Friedrich aufgestellten
Baracken Unterkunft gefunden. Der Steiger Heinrich Enders aus Sörth erinnert sich an etwa zwanzig Ausländer aus mehreren
Nationen, die auf der Grube Wingertshardt bei Niederhövels gearbeitet hätten. Diejenigen, die etwas
Deutsch gesprochen haben, mußten die anderen Ausländer bei der
Arbeit anleiten. Auch auf den Gruben Katzwinkel und Eupel
wären Ausländer eingesetzt gewesen. Die Unterkünfte für sie befanden sich jeweils
auf dem Betriebsgelände. Der
Bergmann Wilhelm Schmidt aus Eichelhardt bestätigt
diese Angaben und berichtet darüber hinaus
über die dort verabreichte schlechte Verpflegung für die Ausländer. Die Bergleute hätten den Ärmsten von zu Hause öfter
Butterbrote und Obst mitgebracht und heimlich zugesteckt. Paul Pitzenthal aus Eichelhardt weiß von zwei Barackenunterkünften für Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter auf dem Gelände der
Grube Friedrich zu berichten. Mehr als einhundert
Leute hätten hier leben müssen; es seien Russen und Ukrainer gewesen, alles
junge Kerls, die in Arbeitstrupps von der Grube Friedrich bis zur Grube Eupel, zur Grube Wingerts-hardt und zur „Alten Hütte“ nach Wissen hätten zu Fuß laufen müssen. Pirzenthal berichtet, daß die
Baracken mit Stacheldraht umspannt und von deutschem Militär zusätzlich bewacht
und abgesichert waren.
Von einigen Bergleuten ist berichtet worden, daß vor allem Unter-Tage zwischen den Ausländern und den
Deutschen solidarisches Verhalten geherrscht habe, allerdings sei das von Grube
zu
Grube noch unterschiedlich gewesen. So hätten es immer wieder vereinzelte
hitzige Nazis gegeben die vor allen russische Kriegsgefangene schikaniert hätten. An
einer Grube des Siegerlandes sei bekannt geworden, daß
ein solcher Nazi bei Arbeiten im Gedinge einen Kriegsgefangenen
totgeschlagen habe.

Foto: A. Dietershagen, Katzwinkel
Heimische Bergleute und Ukrainer (mit kurzgeschorenem Haar) auf der „Grube Vereinigung“ in Katzwinkel
Alwin Dietershagen aus
Katzwinkel war während des Krieges Obersteiger auf der Grube „Vereinigung“ in Katzwinkel.
Er schätzt, daß ca. dreihundert Ausländer auf den
Gruben Friedrich, Eupel und Katzwinkel zu Zwangsarbeiten
eingesetzt gewesen seien. Vor allem hätten sich die Ukrainer als gute
Bergbauarbeiter bewährt; sie waren schon zum Teil in ihrer Heimat für diesen Beruf ausgesucht
worden. Ukrainerinnen hätten nur über Tage gearbeitet. Sie hätten ihre
Barackenlager zwischen Kirchen und Wehbach stehen gehabt und seien
auch bei der Lokomotivfabrik Jung in Jungenthal und auf
dem Wehbacher Walzwerk eingesetzt gewesen. Allein auf der
Grube Vereinigung Katzwinkel und Eupel zusammen, so
meint Dietershagen, wären im Laufe der Zeit ca. 220 Ukrainer im Eisenerzabbau
eingesetzt worden. Am 2. November 1941, so
erinnert er sich, sei der erste Transport mit 65 Ukrainern aus dem
Sammellager in Soest auf dem Betzdorfer Bahnhof angekommen. (Sieben von ihnen
wären erst 15 oder 16 Jahre alt
gewesen) Rauchwaren habe man für diese Personen bei der Kreisverwaltung der NSDAP
in Betzdorf abholen müssen. Die Betzdorfer Schuster mußten
die Schuhe der Zwangsarbeiter
besohlen und flicken. 28 der Ukrainer hätten auf dem Grubengelände, die
restlichen unter Tage
arbeiten müssen. Zwei Baracken waren auf dem Betriebsgelände aufgestellt. mit
18 Personen mußten die Zwangsarbeiter in übereinanderstehenden
Betten sich ihren Schlafplatz teilen. Im März 1944 mußten die Ukrainer und
mit ihnen andere Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene auf dem durch Bombenabwurf
demolierten Betzdorfer Bahnhof schwere Aufräumungsarbeiten leisten. Andere Kameraden
von ihnen wurden zu diesem Zweck in Altenkirchen eingesetzt, um die von
Bombentrümmern versperrten Straßen aufzuräumen. Wieder andere von ihnen mußten beim Aufbau von Panzersperren in Flammersfeld eine
nutzlose schwere Arbeit
leisten.
Am 23. März 1945, weiß Alwin Diestershagen weiter zu berichten, mußte
er mit 60 Ausländern zu einem Räumungseinsatz nach einem verheerenden Angriff
durch Bomberverbände auf Wissen marschieren. Von November 1941 bis März 1945
seien sieben Ukrainer an Lungenkrankheiten verstorben. Die Krankheit sei auf die
nasse, ungesunde Arbeit und sicher auch durch ungenügende Hygiene zurückzuführen
gewesen. Auch auf der Grube „Vereinigung“ durften Bergleute Ausländer
zu wichtigen Erntearbeiten nach Feierabend mit nach Hause nehmen. Besonders sei auch
noch hervorgehoben, daß die Ukrainer für die Bauern
in den Dörfern hin und
wieder deren Schuhe repariert und dafür zusätzliches Essen erhalten hätten.
Kurz vor der Zerschlagung des Dritten Reiches im
Frühjahr 1945 mußten sich in der ganzen Gegend des Siegerlandes
Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene sammeln. Sie bekamen für zwei Tage eine
dürftige Marschverpflegung ausgeteilt und mußten in
Abordnungen von den einzelnen Betrieben aus zu größeren Sammelplätzen marschieren.
Unter ihnen befanden sich auch die Ukrainer von der Grube „Vereinigung“.
Auch aus Betzdorf, Wehbach und Wissen kamen große Gruppen. Eine lange Schlange
zog so zu Fuß unter scharfer Bewachung als Marschkolonne zwischen den
zurückflutenden deutschen Militär zu einem vorläufigen Sammellager nach Hachenburg.
Kurz nach der Ankunft in diesem Lager wurde dasselbe von Fliegerbomben getroffen und
zerstört. Allein von der Grube „Vereinigung“ in Katzwinkel befanden sich vier Urkrainer unter den Toten. Sechsundvierzig von ihnen hatten
das Durcheinander benutzt, sich davonzumachen, um wieder an ihre Arbeitsstelle
in Katzwinkel zu gelangen. Sie kamen auch dort an.
Quellen:
1. Fotos,
Dokumente u. Informationen von Dr. Heinrich Stein, Eichelhardt
2.
Bundesknappschaft, Verwaltungsstelle Siegen
3.
Barbara Rohstoffbetriebe GMBH, Wülfrath-Wilhelmshöhe, schriftl.
Informationen
4.
Informationen von Privatpersonen
5.
Informationen der AOK
Zurück / back