
Günter Heuzeroth
Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkrieges im Westerwald
(Aus: Heimatjahrbuch des Kreises Altenkirchen 1985, S. 222-228. - Hier veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Kreisheimatverveins Altenkirchen e.V.)
1. Teil
Obsternte war im Westerwald. September 1939. Letzte Apfel, Birnen und Pflaumen wurden von den Bäumen geholt. Und nebenan auf dem Splittstreifen der Koblenz-Olper-Straße im Oberdorf von Bruchertseifen standen Leute und winkten frohgemuten deutschen Soldaten zu, die als Kradfahrer, in Lastwagen oder Personenautos, den Stahlhelm auf dem Kopf in langen Kolonnen in Richtung Roth fuhren. Auch ein sechsjähriger Junge stand dabei und sah zum ersten Male Soldaten, Uniformen und Gewehre. Er warf den Soldaten Äpfel zu, vor allem denjenigen, die im Kradbeiwagen saßen. Das war schon ein Erlebnis. Anlass zur Ausgelassenheit hätte es eigentlich nicht gegeben. Vielmehr war es ein "schwarzer Tag" deutscher Geschichte an diesem 1. September 1939. Deutschlands Militär hatte Befehl erhalten, Polen zu okkupieren. Es war Krieg!
Fünf Jahre später, ebenfalls im Herbst und zur Obsternte, standen wieder Kinder an derselben Straße und schauten dem Strom der militärischen Fahr- und Marschkolonnen nach, die in beiden Richtungen die Straße füllten. Die Gesichter der Soldaten waren diesmal nicht mehr froh gestimmt wie vor fünf Jahren an dieser Stelle. Verschwitzte Gestalten denen man die Anstrengungen ansehen konnte, bewegten sich eher lust- und mutlos dahin. Kein Wunder, die westlichen Fronten zwischen Frankreich, Luxemburg und Belgien waren weitgehend zusammengebrochen, und sie sollten in der etwas später einsetzenden sinnlosen Ardennenschlacht den Untergang des III. Reiches hinausschieben helfen.
Und es geschah zum dritten Male, dass der nun knapp zwölfjährige Bub wie Stelle mit seinem Spielkameraden an der Straße stand. Etwas mehr als sechs Monate waren vergangen seit dem letzten September. Und wieder schauten sie dem Treiben des Militärs zu. Auf Lastwagen, offen und ohne Planen, wurden zusammengepferchte, ausgemergelte und zerlumpte Gestalten in schmutzigen Uniformen, ohne Rangabzeichen und Schulterklappen, weggefahren. Es waren deutsche Kriegsgefangene. Das Blatt hatte sich gewendet, der 2. Weltkrieg war zu Ende und verloren.
Aber nicht nur sich allein hatte Deutschland Wunden zugefügt. Der Krieg stürzte Millionen Menschen aus allen Ländern in Hunger, Elend, Schmerz und Tod.
Und so sah der Junge an jener Straße zwischen den deutschen Militärkolonnen auch Marschkolonnen von Kriegsgefangenen russischen Soldaten über die von Schlaglöchern übersäte Straße ziehen. Das Auge eines Kindes sieht gut, und sein Herz fühlt wahrhaftig. Ein Jammerbild, was sich dort auf der Straße den Augen bot! Hunderte von Elendsgestalten abgerissen und verschmutzt von oben bis unten, manche nur mit zusammengebundenen Lappen an geschwollenen Füßen, wankten in Dreierreihen als Kolonne über die Straße ins Hinterland vor der näher kommenden Front. Die Augen lagen traurig und tief in ihren bärtigen, abgemagerten Gesichtern. Wachsoldaten zu Pferd und zu Fuß mit geschulterten Gewehren trieben sie vorwärts, ähnlich wie man eine Herde Rinder daher treibt. Der Hunger macht erfinderisch. Um besser überleben zu können, hatten die Gefangenen sich aus weggeworfenen Flugzeug-Bordwaffenhülsen Messingfingerringe gesägt, die sie aufpoliert, auf einen kegelförmigen Stock gesteckt hatten und für etwas Essbares unterwegs in der Marschkolonne bettelnd den an den Straßen Stehenden anboten. Manchmal gewährte es ihnen der eine und andere Wachmann. Auch dem knapp Zwölfjährigen stachen die glitzernden Fingerringe in die Augen. Flugs holte er ungefragt ein paar letzte Brotkanten von dem Wenigen aus Mutters Brotschrank und lief hinter den traurigen Gestalten her. Diese nahmen ihm ab und überreichten den Schmuck, indem sie murmelten: "mager, mager!" Das hieß soviel wie: "Ist aber wenig, was du mir gibst". Der Junge hatte aber nicht mehr! Und die traurigen Gestalten verschwanden langsam Richtung Rother Tannen am Ortseingang von Bruchertseifen.
KRIEGSGEFANGE ZWANGSARBEITER – WOHER SIE KAMEN, UND WAS IST MIT IHNEN GESCHEHEN?
Polen, Ostarbeiter (Ukrainer, kriegsgefangene Russen), gefangen genommene Soldaten aus Frankreich, Belgien, Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien und Italien, von ihnen waren zahlenmäßig unterschiedlich viele in unsere Heimat gebracht worden. Jeder von uns konnte sie damals sehen und erleben: Bei den Bauern in der Ernte, bei Wald- und Straßenbauarbeiten, auf Baustellen, in vielen Industriebetrieben und Wirtschaftszweigen wie dem Walzwerk in Wissen, den Hüttenbetrieben an Sieg und Heller, in den Eisenerzgruben des Siegerlandes und Westerwaldes, auf der Pulverfabrik bei Au/Sieg und an unzähligen anderen Stellen. Sie kamen aus vielen Nationen zu verschiedenen Zeiten, je nachdem wann ihre Staaten von Hitlers Militär überfallen wurden.
Zu diesem Thema schreibt Veit Valentin in seinem Band "Deutsche Geschichte" (Droemersche Verlagsanstalt, München 1960):
"Für Hitler und seinesgleichen waren Menschen nur Objekte, nur Zahlen, nur Rechenmaterial - wie aufs entsetzlichste die ganzen Völkern zugedachten Umsiedlungs-, und Vertreibungsaktionen enthüllten, die zur Verwirklichung wahnwitziger Rassen- und Reichsideologien betrieben wurden. Nach einem 'Generalplan Ost' … sollten 50 bis 80% der slawischen Nationalitäten innerhalb des Reichsgebietes, des Generalgouverments und es eroberten russischen Siedlungsraumes allmählich vertrieben bzw. verbraucht werden..."
Es kann an dieser Stelle nicht auf die Inhalte jener Wahnsinns-Ideologie eingegangen werden. Wer sich dafür interessiert, muss sich mit der reichhaltigen Literatur darüber auseinandersetzen. Hier soll lediglich ein kleiner Überblick aus unserer Region gegeben werden, der sich auf einige Zahlenangaben, Behandlungsmethoden sowie die Ursprungsgeschichte des aufgeführten Personenkreises bezieht. Wahrscheinlich sind es polnische Zwangsarbeiter(innen) gewesen, die als erste in den landwirtschaftlichen Betrieben und der heimischen Industrie eingesetzt wurden.

Aus dem Generalgouvernement Polen, welchem der berüchtigten Generalgouverneur Frank vorstand, wurden ab den Septembertagen 1939 Tausende junger Männer und Frauen für Arbeiten im deutschen Reichsgebiet "verpflichtet". Vierzigtausend Zivilbeamte aus dem Deutschen Reich führten mit den dortigen Dorfschulzen, Polizeibeamten und anderen Organen ihre "Werbefeldzüge" durch und sorgten dafür, dass die von Hans Frank zugesagten polnischen Arbeitskräfte für Deutschland zusammengetrommelt wurden. Die Versprechen der Deutschen an die Polen, dass sie im Deutschen Reich gute Arbeitsmöglichkeiten bekämen, damit sie ihre Familien in Polen ernähren könnten, waren reine Propaganda. Die meist unter aller Würde stehende Behandlung der nach Deutschland "gegangenen" Männer und Frauen sprach sich vor allem bei den Besuchen dieser herum. Es gab kaum noch Polen, die sich freiwillig meldeten. Die Kontingente mussten aber auf "Biegen oder Brechen" erfüllt werden. Die Meldepflicht wurde im Jahre 1940 auf 14- bis 50-Jährige und später bis auf 60-Jährige ausgedehnt.
Die Polen versuchten, informiert über die schlechten Arbeitsbedingungen und Behandlungsmethoden in Deutschland, sich zu drücken, wo sie nur konnten. Die Behörden aber verstärkten den Druck auf sie. Es ist bekannt, dass die polnischen "Zwangsarbeiter", die sie ja wirklich geworden waren, aus Kinos, Lokalen, von Bahnhöfen, aus Häusern und von Strafen abgeholt und in Transporte nach Deutschland gesteckt wurden. Eine große Anzahl von Kindern wurden so von ihren Eltern ohne ihr Wissen getrennt. Sie erhielten noch nicht einmal eine Nachricht über den Verbleib ihrer Kinder oder Angehörigen.
Über die Arbeitsbehörden in Polen in Zusammenarbeit mit den Landesarbeitsämtern (spätere Gauarbeitsämter) und Nebenstellen im Deutschen Reich werden die Zwangsarbeiter, vor allem die Polen und späteren Ostarbeiter wie auch die übrigen Kriegsgefangenen, zu Arbeiten an die hiesigen Firmen und landwirtschaftliche Betriebe vermittelt. Bis zum 14. Dezember 1939 wurden nach Franks Angaben schon 39.000 Polen ins Reich geschickt. 130.000 waren es im März 1940, und bis Ende April stieg die Zahl auf 160.000 Landarbeiter und 50.000 Industriearbeiter an. Das "Soll" aber, wie es hieß, war damit nicht erfüllt worden.
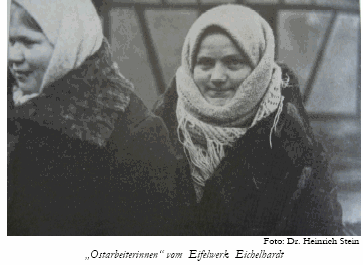
Während der Westoffensive wurden die Zwangsmaßnahmen in Polen noch erheblich verschärft. Immer jüngere Menschen wie auch Ältere werden regelrecht eingefangen. Wenn sich die angeforderten Polen nicht meldeten oder aus Deutschland einige ausrückten oder nicht von ihren Heimatbesuchen an die Arbeitsstellen zurückkamen, wurden über die Familien und Angehörigen "Sippenhaftstrafen" verhängt. Angehörige dieser Personen wurden gezwungen, sich für die Entwichenen zur Verfügung zu stellen. Auch werden Vieh und Gerätschaften wie Möbelstücke als Pfand genommen.
Die schriftlichen Aufforderungen lauteten inhaltlich so:
"Sie werden hiermit auf Grund des Aufrufs des Generalgouverneurs vom 24. April 1940 verpflichtet, sich mit ihren persönlichen Ausweispapieren, dem notwendigen Gepäck, und zeit Verpflegung für 2 Tage am . . . in ... zwecks Aufnahme landwirtschaftlicher Arbeit im Deutschen Reich einzufinden.
Die Nichtbefolgung wird streng bestraft."
Trotz dieser Strafandrohungen stellten sich z. B. im Distrikt Krakau, wie es heißt, nur 20% der Aufgeforderten "freiwillig". Polizeikommandos bestimmten das Straßenbild in jenen Tagen in Polen. Es wurde gejagt, geschlagen und auch geschossen. Menschen wurden nachts aus dem Bett geholt und fortgeschafft. In Polen gab es für die Menschen kaum eine Arbeitsgrundlage, wenig zu essen, kaum Bekleidung. Dennoch wehrten sich die Polen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, Sklavenarbeiter im Nazideutschland zu werden. Trotzdem sollen von den insgesamt ins deutsche Reich deportierten Fremdarbeitern 47% Polen gewesen sein.
Hunderttausende Ukrainer mit der Bezeichnung "Ostarbeiter" wurden auf ähnliche Weise wie die Polen nach Deutschland gebracht, nachdem deutsche Truppen im Jahre 1941 in die Sowjetunion einmarschiert waren.
Als in der zweiten Phase des Krieges ab 1942 die ins Reich gekommenen französischen, belgischen und holländischen Zivilarbeiter wie auch Kriegsgefangene in die Heimatländer zurückgeführt wurden, stieg der Bedarf von "Ostarbeitern" ständig an. Die Nachfrage nach diesen wie nach den Polen war stets groß gewesen, weil aus ihnen weitgehend mehr Profit zu schlagen war. Die Bestimmungen für die Behandlungen gaben der Ausbeutung freien Weg.
Auch in unserer heimischen Industrie wurden diese Maßstäbe angelegt. Die "fremdvölkischen Arbeiter", wie sie salopp und neutral genannt wurden, lehnten sich allerdings immer mehr gegen die Zwangsmaßnahmen in den Betrieben auf. Sie liefen fort, machten krank, wurden widerspenstig. Jedes Mal oder meistens zog dies Repressalien nach sich. Man belangte sie wegen "Arbeitsvertragsbruch" und steckte sie in Haft, gab ihnen schwerere Arbeit oder versetzte sie in Strafkolonnen bzw. KZs. Die Anzahl der Festnahmen erhöhte sich zum Ende des Krieges hin ständig. Ein Spiegelbild davon geben die Gestapo-Berichte aus dieser Zeit wieder.
So hatte Deutschland im Jahre 1942 2 Millionen "fremdvölkische Arbeiter". Das höchste Ergebnis überhaupt bis 1945 wurde im Jahre 1944 mit über 6,5 Millionen Kriegsgefangenen erreicht, davon eine halbe Million Offiziere.
ÜBER DEN EINSATZ DER KRIEGSGEFANGENEN IM KREIS ALTENKIRCHEN
Dem "Chef des Kriegsgefangenenwesens" im Oberkommando der Wehrmacht (OKW) unterstanden die Kriegsgefangenen und deren Einsatz im ganzen Reich grundsätzlich. Die Durchgangslager, "DULAG" genannt, nahmen die Gefangenen im Operationsgebiet vorläufig zur Weiterschleusung ins deutsche Reich auf. Hier gab es dann in den einzelnen Regionen die Mannschaftslager (STALAG) und Offizierslager (OFLAG). Diese Lager unterstanden den Kommandeuren der Kriegsgefangenen bei den Wehrkreiskommandos. In den "STALAGs" hausten jeweils bis zu 30.000 Kriegsgefangene.
Von hier aus wurden die arbeitsfähigen Männer auf Arbeitskommandos verteilt und zum Einsatz gebracht. Ihre Tätigkeiten waren meistens Aufräumungsarbeiten nach Luftangriffen, im Straßen- und Tiefbau sowie in der Landwirtschaft und Industrie.
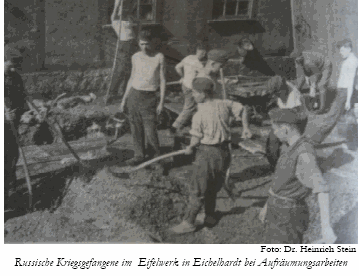
Die im Kreise Altenkirchen eingesetzter, Kriegsgefangenen kamen überwiegend AUS dem STALAG XII D Trier und STALAG XII A Limburg. Außerdem bestand ein OFLAG in Hadamar beim Wehrkreis XII, zu denen die Mannschaftslager ebenfalls gehörten. Im STALAG selbst hielt sich eine relativ geringe Zahl von Kriegsgefangenen auf. So ist z.B. in einem Bericht des STALAG XII D Trier vom 6.3. 1944 nachzulesen, dass von den rund 32.000 dem Lager angehörigen und zu betreuenden Gefangenen sich nur 2.000 im Lager selbst befinden, Alle anderen waren überall in den Kreisen als Arbeitskommandos eingesetzt, die vom deutschen Militärpersonen oder so genannten Landjägerbataillonen bewacht wurden.
Das "Gauarbeitsamt Moselland" in Koblenz und die jeweiligen Arbeitsamtsnebenstellen, für den Kreis Altenkirchen damals in Neuwied, hatten die Aufgabe, je nach Anforderung und Bedarf der Firmen bzw. Landwirte diese Arbeitskräfte dort zu vermitteln.
Folgende Statistik zeigt die Belegungsstärke und die Zusammensetzung der beiden zuständigen STALAGs für die Westerwaldregion:
| 1. Stand 1. 1. 1943 (STALAG XII A Limburg) | |||||
| Franzosen | Belgier | Polen | Süd/Ost | Sowjetunion | Insgesamt |
| 28.923 | 558 | 1.136 | 41 | 8.083 | 38.741 |
| 2. Stand 1. 1. 1943 (STALAG XII D Trier) | |||||
| Franzosen | Belgier | Polen | Süd/Ost | Sowjetunion | Insgesamt |
| 26.981 | 174 | 544 | 3.359 | 8.083 | 34.405 |
| 3. Eine Zusammenfassung (aus beiden Lagern vom Dezember 1944) | |||||
| Franzosen | Briten | Belgier | Polen | Serben | |
| 64.359 | 1.754 | 943 | 5.422 | 7.452 | |
| Sowjetunion | Italien | USA | Holland | versch. | |
| 37.574 | 12.197 | 1.420 | 47 | 992 | |
| davon 729 Offiziere / Gesamt: 132160 im Arbeitseinsatz davon 95120 Kriegsgefangene. | |||||
Die Gefangenen von über 10 Nationen machen deutlich, mit wie vielen Staaten Deutschland damals im Krieg stand. Der zwischenzeitliche Stand, welcher nicht aus der Statistik hervorgeht, weist seit 1941 immer mehr russische Kriegsgefangene in den STALAGs auf. Zu Anfang des Russlandfeldzuges, vor allem im Raum Dnjepr, Donez und Leningrad, wurden ungeheure Gefangenenmassen registriert. So machte man z.B. bei der Kesselschlacht von Kiew 665.000 Gefangene. Diese Massen von "Untermenschen", wie sie die NS-Ideologie bezeichnete, mussten irgendwo unterkommen und auch ernährt werden. In den Lagern brachte das oft unüberwindbare Schwierigkeiten mit sich. Flecktyphus und Ruhr brachen aus und ließen viele von diesen sowieso schon halbverhungerten Wesen sterben. Unter allen Gefangenen waren bei den Russen die meisten Verluste zu verzeichnen. Dem Oberkommando der Wehrmacht und anderen Dienststellen war die Situation bekannt. Dazu soll hier ein Schreiben des militärischen Befehlshabers i. G. v. 20. Okt. 1941, also noch in einem sehr frühen Stadium angeführt werden. Hier heißt es:
"Besprechungsergebnis…
Ins Reich sollen 660.000 Kgf. Russen abgeschoben werden. Ernährung ist nur für 300.000 vorhanden. OKW hat Kenntnis davon, daß das Massensterben unter den Kriegsgefangenen nicht aufzuhalten ist, da diese mit ihren Kräften am Ende sind. Es kann weder erhöhte Verpflegung noch können Decken zur Verfügung gestellt werden ... da dann auch keine Arbeitsleistung verlangt werden kann …"
Am 1. Mai 1944 sollen sich über fünfeinhalb Mill. russische Kriegsgefangene im Deutschen Reich befunden haben. Gestattete man z.B. belgischen und französischen Kriegsgefangenen speziellere Arbeiten wie Lokheizer bei der Bahn, Maschinenarbeiten usw. auszuführen, so unterlagen die russischen Kriegsgefangenen grundsätzlich der Sonderbehandlung.

Ein Merkblatt von Geboten, welches herausgegeben war, lässt dies deutlich werden:
"...Einzelhaft als Methode bei Vernehmungen. Jeder Verkehr mit sowjetischen Kriegsgefangenen ist zu verhindern.
Strenge, aber korrekte Behandlung.
Auf Flüchtige ist sofort ohne vorherigen Haltruf zu schießen. Bei Beerdigungen sind die Beisetzungen unauffällig vorzunehmen. Die Behandlung in Rundfunk und Film ist verboten. Särge sind nicht vorgeschrieben, jedoch ist jede Leiche ohne Bekleidungsstücke … sofern diese anderswo verwendet werden können ... mit starkem Papier oder sonstigen geeigneten Material einzuhüllen …"
Die Kriegsgefangenen sind auch bei uns im Heimatraum in den verschiedensten Unterkunftseinrichtungen über Nacht untergebracht worden. Meist waren es aufgestellte Baracken, alte Häuser oder auch Gaststättensäle, die zur Verfügung gestellt werden mussten. So waren ein altes Bauernhaus in Haderschen, ein Gasthaussaal in Obererbach und in einer Baracke in der Nähe des Blücherplatzes in Altenkirchen. Viele Betriebe, wie das Walzwerk in Wissen, Hütten- und Grubenbetriebe sowie die Pulverfabrik in Hamm, hatten selbst Räumlichkeiten auf ihren Grundstücken für Kriegsgefangene wie für "fremdvölkische Arbeiter" errichtet.
----------------------------
Quellennachweis für den 1. Teil:
1. Bundesarchiv Abtl. Militärarchiv Freiburg, Bestände: RH u. RW
2. Interviews und Informationen mit und von Privatpersonen
3. Schriftliche Informationen verschiedener Gesellschaften und Firmen
4. Eva Seeber "Zwangsarbeiter in der faschistischen Kriegswirtschaft" / Deutscher Verlag der Wissenschaft Berlin 1964