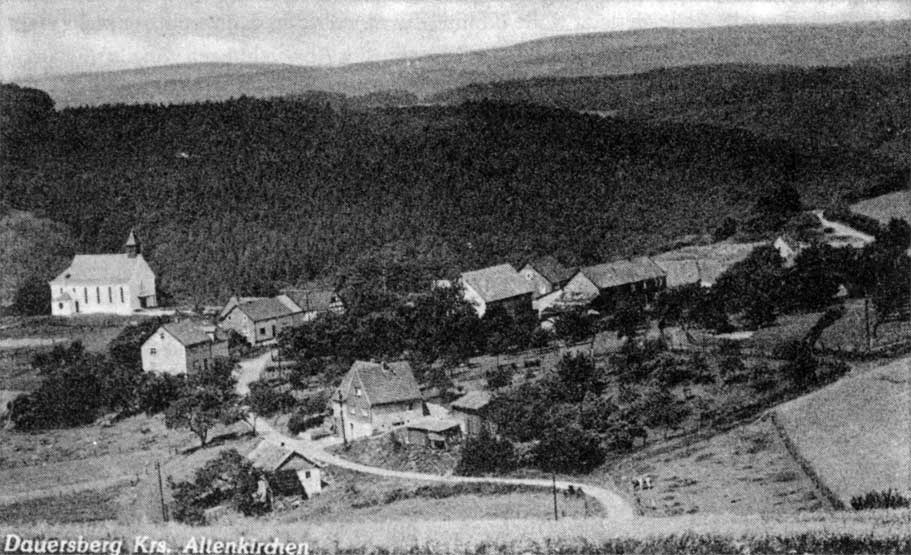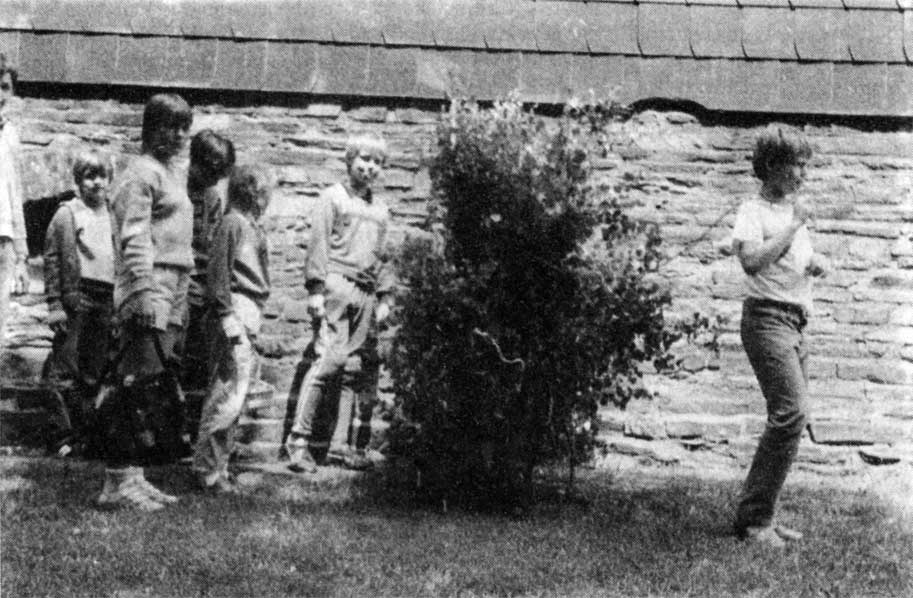O. Zimmermann
Dauersberg
Porträt einer Gemeinde
(aus: Heimatjahrbuch 1986 für den Landkreis Altenkirchen - Hier
veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des
Kreisheimatvereins)
"Douerschbisch" - wie die Alteingesessenen
liebevoll ihren Heimatort nennen - gehört seit 1969 mit seinen
(heute) 240 Einwohnern zu dem in Luftlinie etwa drei Kilometer
entfernten Betzdorf und war davor bereits Teil der
Verbandsgemeinde. Es liegt von Feldern, Weiden und Wäldern
umgeben, durch einen Bergrücken von Heller- und Siegtal getrennt
in halber Berghöhe zum Eibbachtal hin. Dr A. Wolf schreibt in
seiner "Geschichte von Betzdorf" u. a. über
Dauersberg:
Dennoch ist seine Zugehörigkeit zu uns uralt, wird sie doch
schon 913 durch die Haigerurkunde bezeugt.
Genaugenommen wird in der angeführten Haiger- und der
Folgeurkunde von 1048 lediglich der Umfang einer Schenkung des
Saliers König Konrad an die Kirche ausgewiesen, wobei die Dauersberger
Gemarkungsgrenze an "... der Elbena bis nach Wizzenstein und
von Wizzenstein bis nach Angeshart" allerdings auch heute
noch der Pfarrsprengelgrenze von Haiger aus jener Zeit
entspricht. Doch - nehmen wir es einmal nicht so genau, im
Gegenteil, gehen wir noch einmal über tausend Jahre weiter
zurück und versuchen uns ein Bild zu machen, wie es damals hier
war oder gewesen sein könnte.
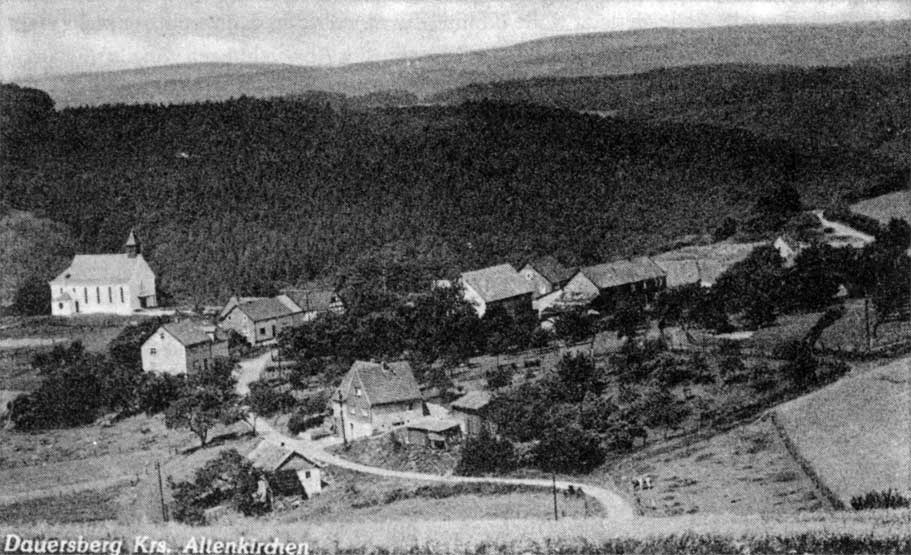
Dauersberg mit der Marienkapelle um 1953
Damals beherrschte ein sehr
rauhes Klima das von fast undurchdringlichen Wäldern bedeckte
Land; in den Talniederungen hatten Flüsse und Bäche riesige
Sumpfgebiete gebildet, und ein mit zahllosen Steinen
durchsetzter, kalter Lehmboden ermöglichte selbst bei härtester
Arbeit nur geringe Erträge. Wahrlich kein einladendes
Siedlungsgebiet.
Doch den Kelten, welche in kleinen Gruppen den
Erzreichtum der Gegend auszunutzen verstanden, genügte, was sie
vorfanden, und so kam es nach den gelegentlich durchziehenden Jägern
und Sammlern zu einer ersten, dünnen Besiedelung unserer
näheren Heimat.
Inzwischen waren aber die bis weit im Osten lebenden Germanen
nach Westen hin in Bewegung geraten, und etwa um 300 v. Chr.
wurden die Kelten von den Ubiern über den Rhein verdrängt,
soweit sie sich nicht mit den Eroberern vermischten. Doch bald
gerieten diese unter den Druck der ihnen folgenden Chatten, und
Cäsar siedelte etwa etwa 48 v. Chr. mit den Römern befreundeten
Ubier in den Köln-Aachener Raum um, nachdem er ihn vorher ganz rigoros
von den aufmüpfigen Eburonen entvölkert hatte.
Von den Römern wissen wir, daß sich nun folgendes Bild ergab:
Etwa vom Main bis zur Lahn siedelten die Chatten, anschließend
bis über die Sieg die Sigambrer und in Rheinnähe dieses Gebietes
bis über die Wupper die Tenkterer, denen die Usipier folgten.
Dabei sollte nicht übersehen werden, daß die Grenzen dieser
Gebiete fließend waren und nicht so scharf umrissen, wie wir die
heutigen Grenzen kennen. Zu bedenken ist auch, daß die
berichtenden Römer gerade in unserem Gebiet ihren Machtbereich
nur geringfügig auf das rechte Rheinufer ausgedehnt hatten und
in den unwegsamen Wäldern und Sümpfen von Westerwald und
Siegerland durchaus noch Volksgruppen leben konnten, von denen
die Römer nie erfuhren oder die für sie zu unbedeutend waren,
um darüber zu berichten. Für ihr Vorhandensein sprechen jedoch
Funde, welche weder den Kelten noch den Germanen zugesprochen
werden können.
Mit dem schwindenden Einfluß der Römer im vierten und
fünften Jahrhundert und der unter den Merowingern mehr und mehr
erstarkenden Herrschaft der Franken, die ihrem Reich eine immer
größere Ausdehnung erkämpften, ergaben sich wesentlich bessere
Lebensbedingungen. Die Folge war, daß die Bevölkerungszahlen
auf das Doppelte, teilweise sogar Dreifache anstiegen und damit
in den Jahren von etwa 500 bis 700 eine Siedlungswelle
auslösten. Hatten sich bis dahin die jeweiligen Eroberer damit
begnügen können, die Nutzflächen der Vertriebenen zu
übernehmen, so mußten nun neue Siedlungsräume erschlossen
werden. Da aber das gute Land besetzt war, mußten Neugründungen
jetzt auch in den abgelegenen oder weniger fruchtbaren Gebieten
vorgenommen werden, deren Besiedelung bisher zu mühselig
erschien. Zu diesen un- oder nur schwach besiedelten Gebieten
gehörten mit ziemlicher Sicherheit große Gebiete von Siegerland
und Westerwald.
In dieser Zeit von 500 bis 700 haben m. E. freie Männer den
Ort Dauersberg gegründet, obwohl die namengebende Kultstätte
noch älter sein dürfte. Die unmittelbare Nähe des "Weiselsteins"
- der auf Grund seiner Gesteinsart wohl kaum mit weißer Stein,
sondern doch wohl eher als "Weiser Stein" zu
akzeptieren ist -, an dem eine altgermanische Gerichtstätte
vermutet wird, könnte das Bild Dauersbergs als einer dem Donar
geweihte Kultstätte durchaus abrunden. Donar oder Thor war neben
seinem Vater Odin der mächtigste der germanische Götter. Er war
Herr über Blitz, Donner und Wind und bewirkte mit seinem Hammer
Mjölnir die Fruchtbarkeit. Da ist es kein Wunder, wenn sich
die noch sehr naturabhängigen Altvorderen in den Schutz eines so
mächtigen Herrn begaben, zumal die zum Eibbach hin steil
abfallende Bergnase einen in der Umgebung außergewöhnlich
beeindruckenden, markanten Punkt abgibt.
Für die Gründungszeit spricht auch ein m. E. bisher viel zu
wenig beachteter Umstand, nämlich daß das im 8. Jahrhundert
bereits schon recht erstarkte Christentum Neugründungen heidnischer
Kultstätten wohl kaum mehr geduldet oder zugelassen hätte.
Vergessen wir nicht, daß die erste Berührung mit dem Evangelium
in unserer weiteren Umgebung bereits in der ersten Hälfte des 4.
Jahrhunderts erfolgt sein kann, als aus Trier der Presbyter
Lubentius nach Dietkirchen (bei Limburg) an die Lahn kam, dort
das Evangelium predigte und ein Bethaus errichtete. Ausgerechnet
nahe dem germanischen heiligen Hain Reckenforst! Deshalb halte
ich es -obwohl es interessant ist - nicht für so wichtig, ob
Bonifatius einige hundert Jahre später an der Nister oder der
Lahn missioniert hat, denn bei der dünnen Besiedelung dürften
sich besondere Ereignisse schon aus Selbsterhaltungstrieb sehr
schnell herumgesprochen haben.
Völlig klar ist unser Dauersberg jedoch zu erkennen, als am 25.
März 1291 der Ritter Roricus de Gevertzhahn und seine Frau der
Abtei Marienstatt urkundlich eine Rente von ihren Gütern zu Tursberg
stiften (Staats. Arch. Idstein, Abtei Marienst. Nr. 130).
Dauersberg erscheint dann im Lauf der Jahrhunderte immer wieder
einmal in den Urkunden, sei es durch Urteile oder
Übertragungen von Rechten oder Grundbesitz, sei es wegen der
Dauersberger Mühle. Diese Mühle wird zwar ausdrücklich erst
1704 erwähnt, ist aber mit Sicherheit auch einige hundert Jahre
älter. Sie war außer für die Dauersberger noch für Eiben,
Gebhardshain, Fensdorf und Steineroth zuständig und hatte zu
jener Zeit 72 Mahlgäste. Mühlengerechtsame konnten jedoch nur
durch den Landesherren verliehen werden, deshalb war auch diese
Mühle herrschaftlich. Der Müller erhielt für das Mahlen einen
Teil des Getreides, die sogenannte Molterfrucht. Mit steigendem
Geldumlauf wurden die Naturalabgaben jedoch immer mehr durch
Bezahlung ersetzt, zumal der Landesherr die Pacht mehr und mehr
in bar forderte.
Die Dauersberger scheinen sich aber in all den Jahrhunderten ihre
ursprüngliche Freiheit erhalten zu haben, denn in keiner der
zahlreichen Urkunden ist vom Gegenteil die Rede. Altes, grundherrschaftliches
Eigentum hat es in Dauersberg nie gegeben, die Güter des
Gebhardshainer Ritters Roricus in Dauersberg um 1291 sind nur
eine Episode gewesen.
Die Namen einer ganzen Reihe von früheren Dauersbergern haben
sich bis heute im Ort erhalten, wenn auch der um 1550
auftauchende Name "Stinnert zu Taursperg mit Frau Byla"
mit dem seit einigen Generationen die Mühle betreibenden Stinner
nicht verwandt sein soll. 1624 gibt die Einwohnerliste 12 Namen
an, wobei es sich wohl um die Familienvorstände oder Rauchbesitzer
handeln dürfte. Nimmt man bei dem damaligen Kinderreichtum nur
fünf Personen pro Namen an, so hatte Dauersberg zu dieser Zeit
mindestens 60 Einwohner. Bei den 1693 erscheinenden 13 Namen sind
bereits die heutigen Pfeiffer und Itenbach (Eutebach)
vertreten. 1724 sind es bereits 19 Namen, und zu Pfeiffer und
Eutebach kommen Bierbaum und Muhl. 1743 ist die Bevölkerung auf
22 Haushalte angewachsen, damit war der Höhepunkt der Ernährungsmöglichkeiten
erreicht. In den Jahren bis etwa 1820 hatte sich die
Einwohnerzahl auf etwa 110 eingependelt. Das änderte sich
jedoch, als durch Bergbau und Hütten, Steinbrüche und später
die Eisenbahn bessere Verdienstmöglichkeiten entstanden. Waren
es 1840 noch 165, so wohnten 1895 bereits 220 Menschen in dem
kleinen Dorf. Doch auch hier spielten sich die Einwohnerzahlen in
den Jahren von 1919 bis 1961 auf etwa 180 ein. Hatte man bis in
die fünfziger Jahre von etwas Landwirtschaft, Waldwirtschaft
(Hauberg) und dem außerhalb ausgeübten Beruf gelebt - fast jede
Familie besaß Vieh, Land, Wald oder Hauberg -, so besserten sich
die Verdienstmöglichkeiten so, daß man anfing, den mühevollen
landwirtschaftlichen Nebenerwerb mehr und mehr zu verkleinern und
endlich vielfach ganz aufzugeben. Die Industrie hatte in
Betzdorf, Kirchen, Wissen und der Umgebung Betriebe errichtet,
die Eisenbahn brauchte Kräfte, und die verbesserten
Verkehrsverbindungen ermöglichten es, Arbeitsplätze auch in
entfernteren Werken anzunehmen. So blieben im Ort nur zwei Vollerwerbs-Landwirte
und vier Nebenerwerbsstellen erhalten.
Dennoch wird Dauersberg nach wie vor von der Land- und
Forstwirtschaft geprägt, wodurch sich der Ort sehr viel von
seiner Ursprünglichkeit bewahrt hat. Die Südwest-Hanglage, die kleine
Kirche auf der Bergnase, von Wäldern umrahmt, mit dem Blick in
das Elbbachtal und auf das hochgelegene, etwa drei Kilometer
entfernte Gebhardshain, geben dem kleinen Dorf auch heute noch
etwas Idyllisches. Leider ist an altem Fachwerk nicht mehr viel
erhalten, aber der gepflegte Ort brachte es bei den
Dorfverschönerungs-Wettbewerben 1982 und 1984 immerhin auf
zweimal Gold im Kreis Altenkirchen, einmal Gold im
Regierungsbezirk Koblenz und zweimal Silber im Land
Rheinland-Pfalz!
Um 1745 bildete sich eine katholische Schulgemeinschaft zwischen
Steineroth und Dauersberg, die erst 1810 endete, als die
Dauersberger ein eigenes kleines Schulhaus mit ausgebauter
Hirtenwohnung errichteten. Dieses Haus - es steht noch in
umgebauter Form und gehört seit langem der Familie Arndt, die
nach dem Erwerb noch eine ganze Zeit "aal Schull's"
genannt wurde -diente bis 1881 als Schule mit Hirtenwohnung. Dann
wurde eine größere Schule mit Lehrerwohnung gebaut und ein
Schulgarten angelegt. 1969 wurde die Schule an Privat verkauft,
und die Kinder besuchen im Zuge der Eingemeindung nach Betzdorf
die dortigen Schulen.

Alte Schule um 1912
Im Jahre 1851 stiftete der
Bezirksschornsteinfegermeister Runkel aus Gebhardshain den
Dauersbergerneine Glocke. Leider war bisher nicht zu erfahren,
warum, ebenso wäre es interessant zu wissen, wo diese Glocke
geblieben ist, denn bereits 1854 kauft die Gemeinde für 54
Thaler und 15 Silbergroschen eine neue Glocke. Diese wurde im
letzten Krieg eingeschmolzen, und die Gemeinde entschloß sich
1949, für eine neue Glocke zu sammeln. Das Ergebnis dieser
Sammlung war so gut, daß man in einer Glockengießerei in Brilon
eine Glocke mit der Umschrift "Maria heiß' ich - die toten
Helden bewein' ich" bestellen konnte. Da in Dauersberg weder
Kapelle noch Kirche vorhanden war, wurde die Glocke nach einer
feierlichen Glockenweihe auf dem Schulhof in ein Gerüst
gehängt. Bei dem Weihefest waren, durch Spenden und Anschlagen
der Glocke mit der Hand von Einheimischen und Gästen rd. 500,-
DM zusammen gekommen, und es wurde überlegt, ob man diese Summe
als Grundstock nehmen sollte, den Dauersbergern eine Kirche und
der Glocke ihren endgültigen Platz zu bauen.
Schon im September 1949 fand die Gründungsversammlung des
Kirchbauvereins, am 16.7.1950 die Grundungsteinlegung statt, und
bereits am 9. September 1951 wurde die Kirche eingeweiht. Und so
kam Dauersberg durch Zielstrebigkeit, Opferbereitschaft und
Fleiß in atemberaubendem Tempo zu einer Kirche. Als Nebeneffekt
wurde dadurch auch der 1887 gegründete und seit dem 2. Weltkrieg
ruhende Männergesangverein wiederbelebt und konnte 1957 ganz
groß sein 70jähriges Bestehen feiern.
Etwa 1925 schaffte der damalige Müller Richard Stinner einen
Generator an, mit dem er -leider mit ständig wechselnder Stärke
- die Dauersberger mit Strom versorgte, bis der Energiebedarf im
Ort so groß wurde, daß das E-Werk die Versorgung übernahm.
1929 erfolgte die Verlegung der Wasserleitungen, die
Wasserschlepperei hörte auf. Obwohl fast alle Häuser im oder am
Hause Brunnen oder Quellen hatten, war es doch so bequemer. In
einer Nebenerwerbslandwirtschaft wird noch heute aus einer
solchen Hausquelle das Vieh mit Wasser versorgt. 
Männergesangverein "Concordia" Dauersberg 1957
Der Krieg war mit dem
kleinen Dorf bis dahin noch recht gnädig umgegangen, doch ganz
zum Schluß schlug am 8. März 1945 eine Bombe voll in ein Haus
ein und tötete drei Frauen. Die außergewöhnliche Tragik liegt
bei diesem Geschehen darin, daß eine dieser Frauen aus Betzdorf,
die andere aus Köln vor den Bomben in das ruhige Dauersberg
geflohen waren. Alle anderen Bomben dieser Angrifsswelle fielen
ins freie Feld.
Bisher hatte sich Dauersberg seine Abgeschiedenheit erhalten
können. Es gab keine Industrie, ja selbst für einen
Handwerksbetrieb war das kleine Dorf nicht attraktiv genug. Ein
Kolonialwarenladen und mit wechselnden Standorten ein
Flaschenbierverkauf oder eine improvisierte Wirtschaft waren
alles, was der Ort an Attraktionen zu bieten hatte. Aber dann kam
der Fortschritt doch, und zwar in Form des Straßenbaus. Die
von der Landstraße Betzdorf-Steineroth nach Dauersberg
abzweigende Kreisstraße endete nämlich hier und wurde nun nach
Eiben weitergeführt, und das bedeutete, daß man nicht mehr auf
Feld- und Wiesenwegen zur Mühle oder nach Weiselstein zu holpern
brauchte. Sicher, der Fernverkehr führte nach wie vor weit entfernt
am Dorf vorbei, aber Dauersberg war mit einem Male viel leichter
zu erreichen. Und dann war plötzlich ein gemütlicher Dorfkrug
da und ein gut bürgerliches Hotel im Ort, eine zögernde
Bautätigkeit begann, und 1969 kam es zur Eingemeindung nach
Betzdorf, mit der beide Teile sehr zufrieden sind - und es wohl
auch sein können. Besonders erfreulich war in diesem Zusammenhang,
daß bei der Straßenbenennung die alten Flurnamen wieder zu
Ehren gekommen sind und die Stadt- und Ortsväter sparsam mit den
Baugebieten umgehen. Eine gute Lösung war es auch, die
Verkaufssumme der Schule für einen Kinderspielplatz mitten im
Ort zu verwenden.
Vieles an altem Brauchtum hat sich hier erhalten; so ziehen in
der Karnevalszeit die bis zur Unkenntlichkeit vermummten Jecken
von Haus zu Haus und fordern stumm (um sich nicht zu verraten)
ihren Schnaps, die Sternsinger bitten um eine Gabe, und im Mai
tragen die vier kräftigsten Kinder das schwere Maimiesbündel
aus Birkengrün durch das Dorf und singen an jedem Haus: "Maimies
will wat haan, will wat in ihr Säckelchen haan" und "Der
Mai ist gekommen". Noch vor etwa zehn Jahren wurde ein Junge
in ein leichtes Birkengrünbündel gebunden, lief in der
Sängergruppe mit und rief ein lautes "Kuckuck-Kuckuck"
zwischen die Liedertexte. 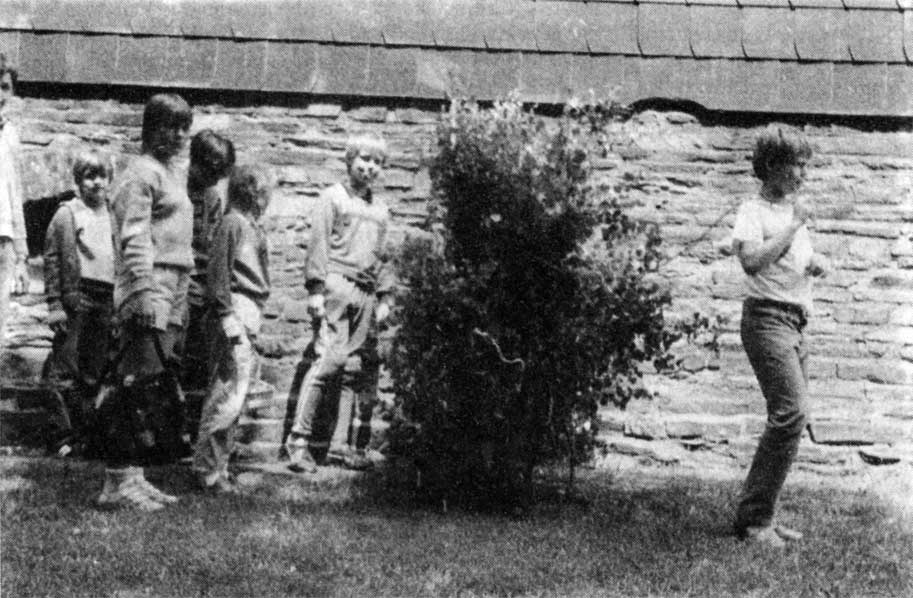
Jugend mit dem Maimies
Als es immer schwieriger
wurde, einen "Kuckuck" zu finden, ließ man den Jungen
weg und vergrößerte dafür das Maimiesbündel.
Der Maibaum - der übrigens bei uns seit eh und je eine Birke ist
- mit seiner nächtlichen Bewachung hat in letzter Zeit eine neue
Variante erfahren, und das kam so: Seit über zehn Jahren besteht
zwischen der hiesigen Jugend und den jungen Leuten von Fresen in
der Steiermark eine inoffizielle, herzliche Partnerschaft. Von
dort wurde der Brauch des "Maibaumziehens" importiert.
Zur Kirmeszeit kann jeder die Länge des Maibaumes schätzen, der
dann umgelegt wird, wer am genauesten geschätzt hat, erhält
einen Preis. Dann werden eine Reihe von Mannschaften aus Männern
oder Frauen gebildet, welche um die Wette den Maibaum über eine
festgelegte Strecke ziehen müssen. Außer viel Gelächter gibt's
auch hier Preise zu gewinnen.

Feuerwehr mit Storch
Die Klepperjugend vor Ostern
und das Martinsfeuer mit dem berittenen St. Martin gehören genau
so dazu wie das herzhafte Rappeln zum Polterabend. In den letzten
Jahren hat sich noch der Storch auf dem Dach dazu gesellt, der
wie von Geisterhand in der Nacht, bevor die junge Mutter mit
ihrem Kinde aus der Klinik heimkehrt, auf dem Haus angebracht
ist.
1976 wurde der ehemalige Schulhof noch einmal für das 25
jährige Bestehen der Marienkapelle Dauersberg zur Kirchweih
geöffnet, doch bereits die 30-Jahrfeier konnte 1981 auf einem inzwischen
geschaffenen Festplatz an der Brunnenanlage "Oreborn"
feierlich begangen werden. Da diese Kirchweihfeste für jung und
alt jedesmal viel Freude brachten, werden alljährlich Anfang
Juli einige Tage für die "Kirmes" vorgesehen.
Inzwischen ist der Festplatz mit Hütte, Grillstelle und
Toilettenanlage weiter komplettiert worden und bildet mit dem
Oreborn ein rechtes Schmuckstück unseres Dorfes.
Wir sind am Ende unseres kleinen, rund 2000 Jahre
durchstreifenden Spaziergangs, und was bleibt noch zu wünschen
für unser Dauersberg, für uns alle? Möge es sich in Frieden
gemächlich weiterentwickeln, uns ein schönes Heimatdorf bleiben
und allem Getier, was da läuft und fliegt, schwimmt und kriecht,
seinen Lebensraum behalten lassen, damit unsere Nachkommen ihren Kindern
auch noch den Falken am Himmel, das Reh vor der Eichhardt und die
Forelle im Eibbach zeigen können!
Quellennachweis:
Dr. A. Wolf: Geschichte von
Betzdorf, E. Heyn: Der Westerwald und seine Bewohner, Pfarrer M.
Kröll: Die Pfarrei Gebhardshain, Kreisarchiv Altenkirchen, J. H.
Lamprecht: Die Ämter Freusburg und Friedewald.
Zurück / back